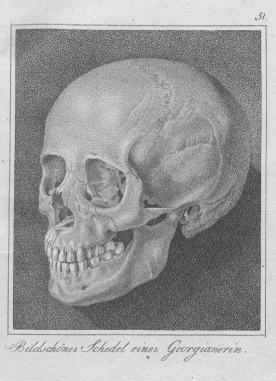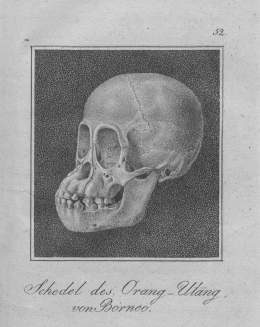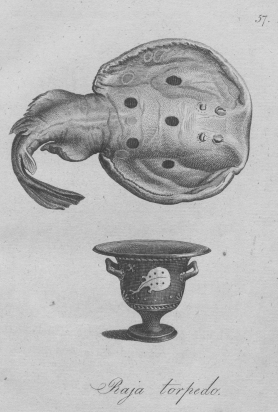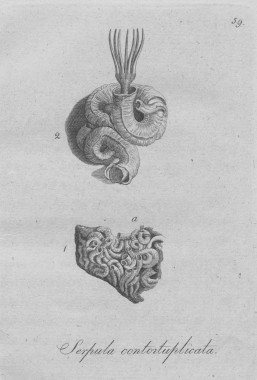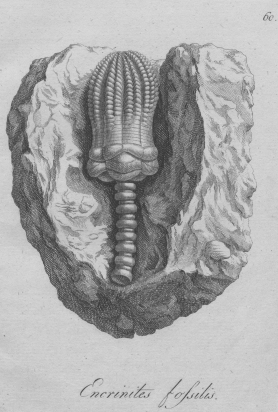[titlePage_recto]
Abbildungen
naturhistorischer Gegenstände
herausgegeben
von Joh. Fried. Blumenbach.
6tes Heft.
Nro. 51-60.
Göttingen
bey Heinrich Dieterich.
1802.
[[2]]
-
51. Bildschöner Schedel eiper Georgianerinn.
- 52. Schedel des Orang-Outang von Borneo.
- 53.
Bradypus tridactylus.
- 54.
Didelphis marsupialis.
- 55.
Falco serpentarius.
- 56.
Emberiza aureola.
- 57.
Raja torpedo.
- 58.
Ostracion bicuspis.
- 59.
Serpula contortuplicata.
- 60.
Enerinites fossilis.
51.
Bildschöner Schedel einer
Georgianerinn.
[[3]]
[interleaf]
[[5]]
Ein Menschenschedel – sey's auch von wel-
chem Volke unter der Sonne es wolle – ver-
glichen mit dem vom allermenschenähnlichsten
Affen, ist allein schon hinreichend, den kör-
perlichen Character der Humanität zu bestim-
men, und die Kluft zu ermessen, welche die
Natur zwischen menschlicher und thierischer Ge-
staltung befestigt hat. Und so finden zwey
musterhafte Abbildungen dieser beiderley sich
so sehr von einander auszeichnenden Schedel-
formen auch in dieser Sammlung eine pas-
sende Stelle.
Der von einem Neger würde zwar ausser-
dem auch zugleich gedient haben, mit einem
Blicke zu zeigen, wie schlechterdings bloss
relativ die Züge sind, wodurch er sich von den
[[6]] Köpfen andrer Menschenrassen unterscheidet;
und wie gänzlich er hingegen durchaus in allem
was nur am Schedel den constanten absoluten
Character der Humanität ausmacht, mit allen
übrigen Völkern übereinkommt, und so gut
wie irgend eines derselben, von der übrigen
thierischen Schöpfung absteht: – Ich habe
aber doch lieber hier diesen gewählt, weil er
wohl allgemeineres Interesse, wegen der be-
wundernswerthen Schönheit seiner Bildung
haben wird, wodurch er sich so auffallend von
mehr als hundert andern Schedeln fremder
Völkerschaften auszeichnet, wozu nun meine
Sammlung angewachsen ist.
Er ist eins der vielen und grossen Ge-
schenke, womit der Herr Baron von Asch
diese Sammlung bereichert hat, und dient zur
Beglaubigung dessen, was ausser so vielen an-
dern Zeugen von der Schönheit der Georgianer,
nahmentlich der philosophische Reisende, Char-
din, von den bezaubernden Reitzen ihrer Wei-
ber sagt*).
52.
Schedel des Orang-Outang von Borneo.
[[7]]
[interleaf]
[[9]]
Also von dem der oben im 11ten Heft tab. 12.
abgebildet worden. Hier sein Schedel, den ich
der Güte des berühmten Naturforschers Hrn.
Dr. van Marvm in Haarlem verdanke, und
der in bestimmten Verhältniss der Grösse zu
dem vorigen Menschlichen gezeichnet ist, un-
terscheidet sich von diesem hauptsächlich
1) durch den Mangel des prominirenden Kin-
nes –, desjenigen Wahrzeichens der Humani-
tät, wodurch sich meines Wissens das mensch-
liche Haupt von allen Thierköpfen auszeichnet.
2) Hingegen durch das Daseyn des berühm-
ten Intermaxillar-Knochens, in welchem auch
bey diesem so wie bey andern Quadrumanen
und so vielen Quadrupeden die obern Vorder-
zähne sitzen; der sich aber bekanntlich auch
[[10]] bey solchen Säugethieren findet, denen diese
Zähne mangeln, oder die überhaupt gänzlich
zahnlos sind; da hingegen beym Menschen
jene Schneidezähne, so wie das ganze obere Ge-
biss, bloss in den beiden Kieferknochen befe-
stigt sind.
Und 3) durch das was die Affen insbeson-
dere vom Menschen distinguirt, wie z.B. die
so dicht aneinander liegenden Augenhöhlen, die
Kleinheit der gleichsam eingedruckten Nasen-
beine, und überhaupt sehr beengten Geruchs-
organe etc.
53.
BRADYPVS TRIDACTYLVS.
Das dreyzehige Faulthier (Aï).
[[11]]
[interleaf]
[[13]]
Der Französische Plinius schildert die Faul-
thiere als die elendesten, kümmerlichsten, von
der Natur stiefmütterlich verwahrlossesten Ge-
schöpfe auf unserm Erdenrund. ‘“Es ist nicht
sowohl Trägheit (sagt er unter andern) was sie
characterisirt, als Elend, Gebrechlichkeit, feh-
lerhafte Bildung; – sie bezeichnen den letzten
schwächsten Grad von möglicher Existenz un-
ter den Thieren, die Fleisch und Blut haben;
– in solchen Missgriffen der Natur noch causes
finales annehmen wollen, würde Kurzsichtigkeit
verrathen.”’ etc. – Die Hauptbelege für diese
Behauptungen sind die bekannten Zeugnisse
der Reisebeschreiber von der allerdings auffal-
lenden Langsamkeit dieser Thiere bey ihrer
Locomotivität.
[[14]]
Allein bey alle dem gewinnt doch die Sache
in der That ein minder klägliches Ansehen,
wenn man anderseits auch nicht vergisst, dass
diesen Thiere bey ihrem Phlegma zugleich das
glückliche Los zu Theil worden, ausserst we-
nige Bedürfnisse zu haben, wenigen Nachstel-
lungen ausgesetzt zu seyn, und sich gegen An-
fall durch Geschick und selbst durch Gebrauch
ihrer starken Klauen vertheidigen zu können.
Sie leben vom Laub der Bäume, saufen nicht,
und wissen den wenigen die Bäume beklettern-
den Raubthieren durch Retirade auf schwan-
kende Aeste zu entgehen, und wie gesagt sich
ihrer im Nothfalle auch durch ihre Krallen zu
erwehren.
Hier diese Gattung erreicht ungefähr die
Grösse eines Caninchens.
Die Abbildung – wogegen freylich die aller-
mehresten der bisher bekannt gemachten seltsam
contrastiren – ist von einem vorzüglich schö-
nen Exemplare genommen, womit Hr. Leibchir.
Lampe in Hannover meine Sammlung berei-
chert hat.
54.
DIDELPHIS MARSVPIALIS.
Das Opossum.
[[15]]
[interleaf]
[[17]]
Es ist nach dem lebendigen Beutelthiere ge-
zeichnet, das ich seit drey Vierteljahren durch
die freundschaftliche Gefälligkeit des Hrn. Dr.
Tidyman zu Charleston besitze, und wovon
ich im IIIten B. von Hrn. Hofr. Voigt's neuen
Magazin ausführlichere Nachricht gegeben habe.
Hier nur ein paar Worte von dem Zitzensack,
dem merkwürdigen Organ, wodurch sich diese
und mehrere andere Gattungen des Didelphis-
Geschlechts, das Känguruh etc. auszeichnen. –
Wenigstens bey dieser Species ist, so lange die
Mutter keine Jungen im Beutel trägt, auch
keine Spur von Zitzen in selbigen zu erkennen;
sondern sie werden erst durchs Ansaugen der
[[18]] Jungen ausgebildet. Mit diesen ist die Mutter
nur ungefähr 14 Tage trächtig, daher sie bey
der Geburt kaum Erbsengrösse haben; aber dann
erst noch volle 10 Wochen lang im Zitzensack
genährt werden; wo sie sich festsaugen, so
dass Ulloa sogar bey einer schon seit drey Ta-
gen todten und in Fäulung übergehenden Mut-
ter noch die Jungen lebendig und im vollen
Saugen angetroffen hat*). Sonst sollen die
Zitzen, nachdem die Jungen entwöhnt worden,
vertrocknen und abfallen.
55.
FALCO SERPENTARIVS.
Der Secretär, Messager du Cap,
Sagittarius.
[[19]]
[interleaf]
[[21]]
Ich habe schon anderwärts unter den Instanzen
gegen die übertriebenen Vorstellungen von Stu-
fenfolge in der Natur, die ganze Classe der
Vögel angeführt, als welche gleichsam isolirt
steht, mit keiner andern zusammenfliesst, und
sich daher auch in den scharfsinnigsten und
kunstreichsten Entwürfen von Kette oder Leiter
in der Natur, nicht ohne sichtlichen Zwang
unterbringen lässt.
Hier dieser Vogel kann nun zu Einem Bey-
spiel statt vieler dienen, wie wenig vollends
in einzelnen Fällen von scheinbarer Aehnlich-
keit in der äussern Bildung der Geschöpfe auf
wirkliche Aehnlichkeit ihrer Verrichtungen und
Lebensweise (– kurz auf das Contingent was
sie zum Gange der Schöpfung beytragen –
[[22]] was doch die Seele aller solcher Vorstellungen
von Stufenfolge seyn müsste) zu folgern ist.
Oft schon hat man diesen mit Adlerkopf und
Raubfängen bewaffneten Vogel, weil er doch
dabey lange Beine hat (vielleicht auch noch der
Nackenfedern wegen) für ein Bindungsglied zwi-
schen Raubvögeln und Reihern angesehen, so
dass ihn selbst manche Naturforscher nicht unter
die Accipitres sondern zu den Grallis gesetzt ha-
ben. Und doch zeigt seine ganze Lebensart, die
Weise wie er seiner Beute Herr wird, kurz
alles was wir, zumahl durch Levaillant,
Vosmaer und I. R. Forster, von seiner thieri-
sehen Oeconomie wissen, wie ganz diese von
der Sumpfvögel ihrer abweicht, und hingegen
mit der von andern Raubvögeln übereinkommt.
Auch ich habe das an dem, den ich in Lon-
don lebendig gesehen, vollkommen bestätigt
gefunden.
Die Zeichnung ist nach einem 2 Fuss 9 Zoll
hohen ausgestopften Exemplare im hiesigen
akademischen Museum gemacht.
56.
EMBERIZA AVREOLA.
[[23]]
[interleaf]
[[25]]
Noch ist mir keine colorirte und überhaupt
keine recht treue Abbildung dieser schönen Si-
birischen Ammer bekannt. Hier diese ist nach
einem ausgestopften Exemplar unter den grossen
Aschischen Geschenken im academischen
Museum verfertigt, das vom Petropawlow-
schen Hafen aus Kamtschatka gebracht worden.
Das hübsche Thier findet sich aber auch in an-
dern Gegenden von Sibirien, zumahl auf den
Pappeln und Weiden der Flussinseln des Irtisch,
Tobol und Ob. –
Grösse und Stimme sind wie der Goldam-
mer ihre.
[[26]] 57.
RAIA TORPEDO.
Der Zitter-Roche.
[[27]]
[interleaf]
[[29]]
Der berühmteste von dem fünf bis jetzt entdeck-
ten electrischen Fischen. Das Phänomen, dass
dieser Roche erschütternde und betäubende Kraft
besitze, war seit 2000 Jahren bekannt, scheint
aber nun erst durch das Licht, das die Unter-
suchung des Galvanismus der Naturlehre und
Physiologie aufgesteckt hat, seine nähere Auf-
hellung zu erhalten.
Die Zeichnung ist halb so lang und breit
als das Original im academischen Museum wo-
von sie genommen worden.
Besonders merkwürdig sind an diesem
Exemplare die deutlichen Spuren von matten
[[30]] Nebenflecken, die sich um und zwischen den
fünf schwarzen Hauptflecken befinden.
Da sich unter einigen alt-etruscischen Va-
sen die ich besitze, eine mit der Figur eines
solchen Rochen befindet, so habe ich eine ver-
kleinerte Figur dieses schönen Gefässes bey-
gefügt. Es ist 7 1/2 Zoll hoch und der obere
Rand hält 8 1/2 Zoll im Durchmesser. –
58.
OSTRACION BICVSPIS.
[[31]]
[interleaf]
[[33]]
In einer schätzbaren Sammlung von Insecten und
einigen andern Thieren aus Schina, die ich vor
kurzen von des Hrn. Erbprinzen von Sachsen-
gotha Durchl. zum Geschenk erhalten, finden
sich auch zwey Exemplare dieses ausnehmend
saubern kleinen Panzerfisches, der mir eine bis-
her noch unbekannte Gattung zu seyn scheint,
da ich alles Nachsuchens ungeachtet noch weder
Beschreibung noch Abbildung desselben auffin-
den kann; und der sich von den bis jetzt ge-
kannten besonders durch die zwey hinter einan-
der stehenden Rückenspitzen auszeichnet, wo-
von ich auch den Trivialnahmen des hier in na-
türlicher Grösse abgebildeten netten Geschöpfs
genommen habe.
[[34]]
Der Körper ist dreykantig und am Bauche
so breit, dass der Umriss eines Querdurch-
schnitts durch die Mitte des Körpers ein ziem-
lich gleichseitiges Dreyeck bilden würde.
Die fensterartige Scheibe an der Stelle der
Augen, ist eine festsitzende hornartige Haut,
die mit dem Augapfel nicht verwachsen war,
als welcher sich (so wie ich das bey mehreren
Fischen und Amphibien gefunden) hinter der-
selben frey bewegen konnte.
Die sehr enge und in dieser Stellung nicht
sichtliche Bronchial-Oeffnung liegt zwischen
dem untern Augenrande und der Brustflosse.
59.
SERPVLA CONTORTVPLICATA.
[[35]]
[interleaf]
[[37]]
Die Conchyliologie, so wie sie sich gewöhn-
lich bloss mit den leeren Schalengehäusen be-
schäftigte, ist wohl schon oft für das mindest
fruchtbare Feld der Naturgeschichte – oder
eigentlich blosser Naturbeschreibung – gehalten
worden. Sie kann aber diesen Vorwurf ableh-
nen und sich der Würde andrer auch für den
Denker nahrhaftern Theile dieser nützlichen Wis-
senschaft nähern, wenn nach und nach die
darin bisher so vernachlässigten Bewohner jener
Gehäuse immer mehr bekannt werden, die dann
gewiss auch mancherley Stoff für die Philosophie
der Thiergeschichte geben können. Und so mag
auch dieses Blatt einen kleinen Beytrag dazu
liefern, das den meines Wissens bisher noch nir-
[[38]] gend abgebildeten Inwohner einer der gemein-
sten Gattung von Wurmröhren vorstellt, den ich
schon a. 1774 zufällig in einer derselben gefun-
den habe. Seine sieben convergirenden Arme
sind an der Wurzel mit ohngefähr 60 kurzen
steifen Fäden besetzt.
Fig. 1. stellt ihn bey a in natürlicher Grösse
vor; Fig. 2. stark vergrössert.
60.
ENCRINITES FOSSILIS.
Lilienstein.
[[39]]
[interleaf]
[[41]]
Die Seelilien, wovon der hier abgebildete so-
genannte Lilienstein das obere Ende macht, und
zu welchen wie zu so vielen andern Petrefacten,
die jetzige Schöpfung wohl kein Original mehr
aufzuweisen hat, müssen in den Zeiten der nun
catastrophirten Vorwelt grosse weite Strecken
des damahligen Meeresbodens in zahllosen Fa-
milien bewohnt haben. Denn um nur einen
Beweis statt vieler dafür anzuführen, so finden
sich nur allein in den Chur-Braunschweigi-
schen Landen, und nahmentlich bey Brüggen
auf dem Wege von hier nach Hannover ganze
Gebirgsmassen von Flözkalk, die einzig aus
Millionen Wirbeln des Stils und andren zerfal-
lenen Gliedern dieser präadamitischen Thiere
bestehen. Das Geschöpf muss am untern Ende
[[42]] seines Stiels mit einem breiten Fusse festgewur-
zelt gewesen seyn. Wie lang der einfache ast-
lose Stiel selbst gewesen, lasst sich nicht be-
stimmen, da noch nie eine ganz vollständige
Seelilie gefunden worden. Das Geschlecht muss
mehrere Gattungen begriffen haben, die sich
sowohl durch die Flächenzeichnung der Wirbel
des Stiels, als durch den Bau des obern – einer
reifen Maysähre gewissermassen ähnelnden –
Körpers unterscheiden.
Hier dieses Stück aus meiner Sammlung ist
von unserm Heinberge, der berühmten Fund-
grube vielartiger und merkwürdiger Petrefacten.
Notes
*).
[[6]]
Voyage en Perse etc. T. I. pag. 171. der Amsterd.
Ausg. 1735. 4.
↵ *).
[[18]]
Relation del viage etc. P. I. T. II. p. 591. Madr. 1748. Fol.
↵